Drei Fragen an Gunnar Schedel: Was macht das Fliegende Spaghettimonster im Alibri Verlag?
Der Alibri Verlag in Aschaffenburg steht für ein säkulares und religionskritisches Profil. Kein anderer deutscher Verlag engagiert sich jedoch auch so kontinuierlich und vielgestaltig für unsere Kirche. Das publizierte Spektrum reicht von Analyse über systematische Theologie bis hin zur Kinderbibel – eine Bandbreite, die ebenso überrascht wie zur Diskussion einlädt. Grund genug, dem geschäftsführenden Verleger Gunnar Schedel drei Fragen zu stellen
Das folgende Interview führte Prof. Dr. Gisela Spätzle, Dekanin des Fachbereichs Religionswissenschaften am Kircheninstitut, mit Gunnar Schedel, dem Geschäftsführer des Alibri Verlags (Aschaffenburg) als Teil einer religionswissenschaftlichen »Oral History« zur Frühphase pastafarischer Systembildung. Unter https://www.kircheninstitut.de/2025/10/24/3fragen-schedel-alibri/ ist es vor einigen Tagen bereits parallel veröffentlicht wurden.
Prof. Dr. Gisela Spätzle: Alibri ist bekannt für ein säkulares und religionskritisches Programm. Wie fügt sich die FSM-Programmlinie in dieses Profil ein – insbesondere ein Titel wie »Die Kinderbibel« (2023)? Und wie ist das Buch »Einführung in das Pastafaritum« (2025) zu verstehen, das in seiner bekenntnishaften, theologischen Ausrichtung bei manchen den Eindruck erweckt, Joseph Ratzinger hätte daran mitgewirkt?
Gunnar Schedel: Im Verlag vertreten wir die Auffassung, dass Religionskritik nicht bloß eine philosophische Fingerübung sein sollte, sondern den Blick auf die gesellschaftlichen Folgen religiöser Praktiken und Denkweisen richten muss. Und wenn ich auf die acht »Am Liebsten Wäre Mir« schaue und das Verhalten der Pastafari, denen ich bislang begegnet bin, berücksichtige, sehe ich keinen Grund für Berührungsängste. Bei Alibri publizieren schließlich auch historisch-kritisch arbeitende Theologen, säkulare Muslime oder der langjährige Vorsitzende einer liberalen jüdischen Gemeinde.
Die »Spaghettimonster-Kinderbibel« steht ganz in dieser Tradition: Kindern wird eigenständiges Denken und Toleranz vermittelt – das liegt exakt auf unserer Verlagslinie. Dass ich einzelnen Aspekten, etwa der Erklärung des Klimawandels, nicht zustimme, kann ich verschmerzen.
Bei der »Einführung in das Pastafaritum« war die Entscheidung tatsächlich schwieriger. Wir haben im Verlag lange diskutiert, ob das Werk nicht zu theologisch sei. Es ist keine leichte Lektüre, sondern erfordert eine tiefere Auseinandersetzung auf mehreren Ebenen. In einer Zeit, in der Kommunikation von 200-Zeichen-Posts geprägt ist, fragt man sich natürlich: Gibt es dafür noch ein Publikum? Wir waren skeptisch. Ausschlaggebend war letztlich der Eindruck, dass die »Einführung« bei einer wirklich reflektierten Lektüre ein theologiekritisches Potential entfalten kann – vermutlich nicht in der Absicht des Autors, aber doch als Ergebnis der Lektüre. Das erinnert ein wenig an die historisch-kritischen Theologen des 19. Jahrhunderts, deren Arbeit Folgen hatte, die sie selbst wohl kaum absehen konnten.
Aktuelle pastafarischer Literatur des Alibri Verlag
Alle Angebote und Informationen unter https://www.alibri.de/
In »Das Fliegende Spaghettimonster. Religion oder Religionsparodie?« (2017) wird das Pastafaritum religionsphänomenologisch und weltanschauungsrechtlich analysiert. Was daran ist heute noch aktuell – und warum lohnt es sich, das Buch auch 2025 noch zu lesen?
Das Religionsrecht in Deutschland verändert sich – leider – nur sehr langsam. Acht Jahre sind da kaum mehr als ein Wimpernschlag. In allen Parteien dominieren die Kräfte, die das bestehende System bewahren wollen. Die Privilegien der Religionsgesellschaften sollen höchstens auf einige dem Staat genehme Gruppierungen ausgeweitet werden. Die Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters gehört nicht dazu.
Insofern beschreibt das Buch weiterhin treffend die Situation einer vergleichsweise jungen Religionsgemeinschaft mit kurzer Tradition. Natürlich hat sich seitdem einiges getan, aber wer verstehen will, wie der weltanschauliche Hase in Deutschland läuft, findet hier immer noch eine fundierte Analyse.
Etwas anders sieht es bei der inneren Entwicklung des Pastafaritum aus: Da passiert viel Dynamisches – das ist für junge Religionsgemeinschaften typisch. Manche Passagen könnten daher ein Update gebrauchen. Mal sehen, ob es irgendwann eine zweite Auflage geben wird.
Welche Resonanz erfahren die FSM-Titel bei den Leserinnen und Lesern? Erhalten Sie Rückmeldungen, die sie als religionskritisch oder gar gotteslästerlich einordnen – und den Verlag dafür kritisieren? Und zugleich solche, die sie als ernst gemeintes Glaubensangebot verstehen – und den Verlag dafür ebenso kritisieren?
Die Resonanz ist schwer einzuschätzen. Abgesehen von ein paar Rezensionen gibt es heute kaum noch direkte Rückmeldungen. Kommunikation hat sich grundlegend verändert: Früher kam viel Post – Belehrungen, Beschimpfungen, manchmal auch Drohungen, oft mit umfassenden Anlagen und immer mit Absender. Heute äußert sich vieles in digitalen Blasen, ohne Dialogbereitschaft, meist anonymer und zufälliger.
Da alle FSM-Publikationen in diese Zeit fallen, lässt sich die Wirkung schwer messen. Besonders bemerkenswert war eine Rezension im Informationsdienst der Einkaufszentrale der Öffentlichen Bibliotheken. Dort schrieb Susanne Brandt:
»Um die Elemente ihres Universums [des Pastafaritum] provokant und schrill ins Spiel zu bringen, wird dabei das in ihren Augen traditionell Religiöse ebenso plakativ, vereinfacht und verzerrt dargestellt.«
Wer ins Buch schaut, erkennt sofort: Das »traditionell Religiöse« wird überhaupt nicht dargestellt – es geht ausschließlich um das Pastafaritum. Frau Brandt sagt schlicht die Unwahrheit. Ziel solcher Rezensionen ist offenbar, Bibliotheken davon abzuhalten, das Buch in den Bestand aufzunehmen.
Weitere Informationen
- Gunnar Schedel beim HPD
hpd.de/autor/gunnar-schedel - Gunnar Schedel bei WhoIsHu
https://who-is-hu.de/node/256 - Der Alibri-Verlag in der Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Alibri_Verlag

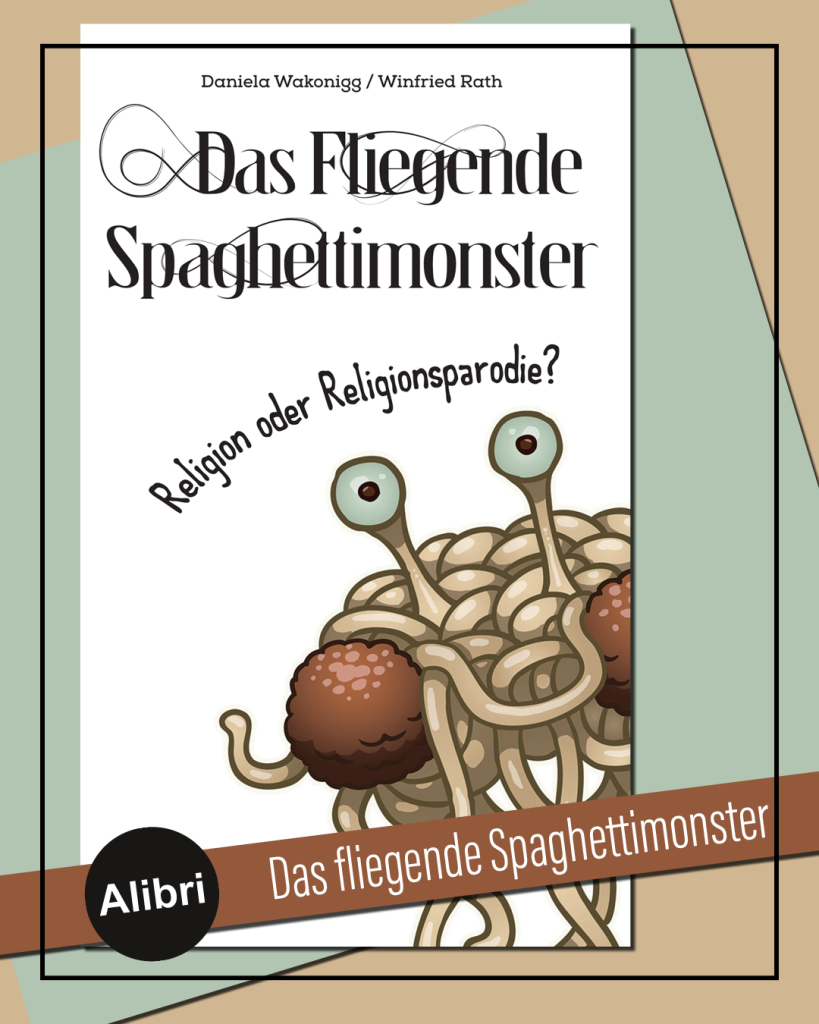
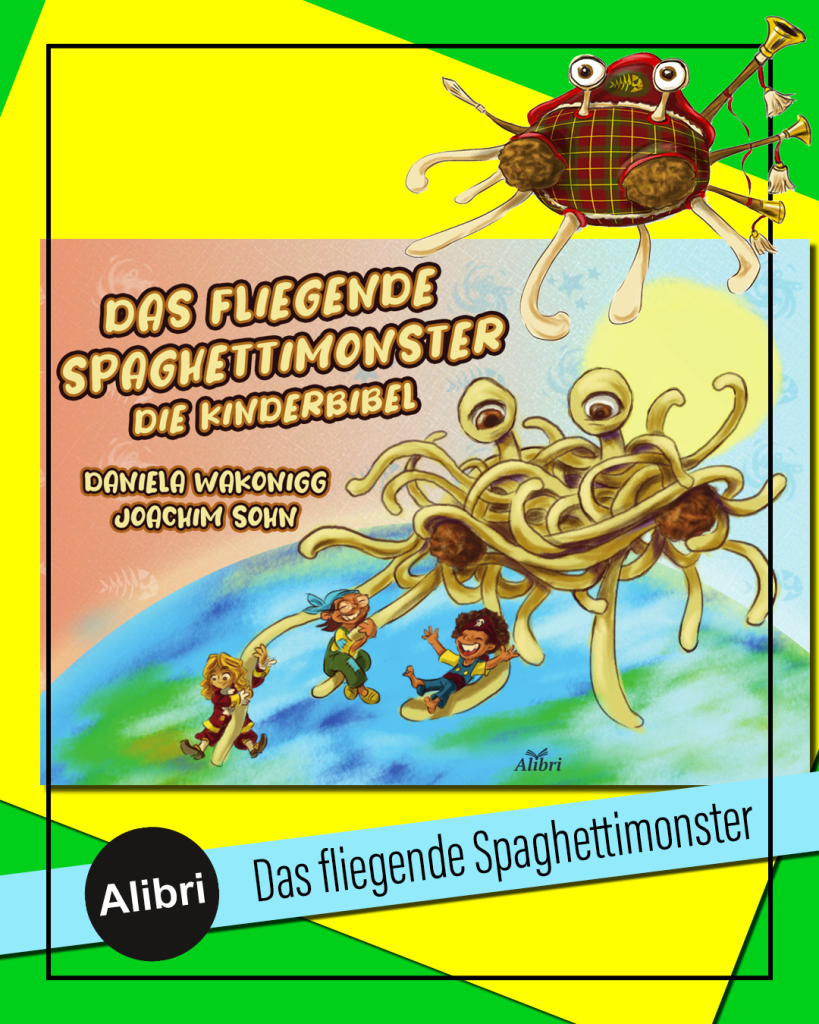
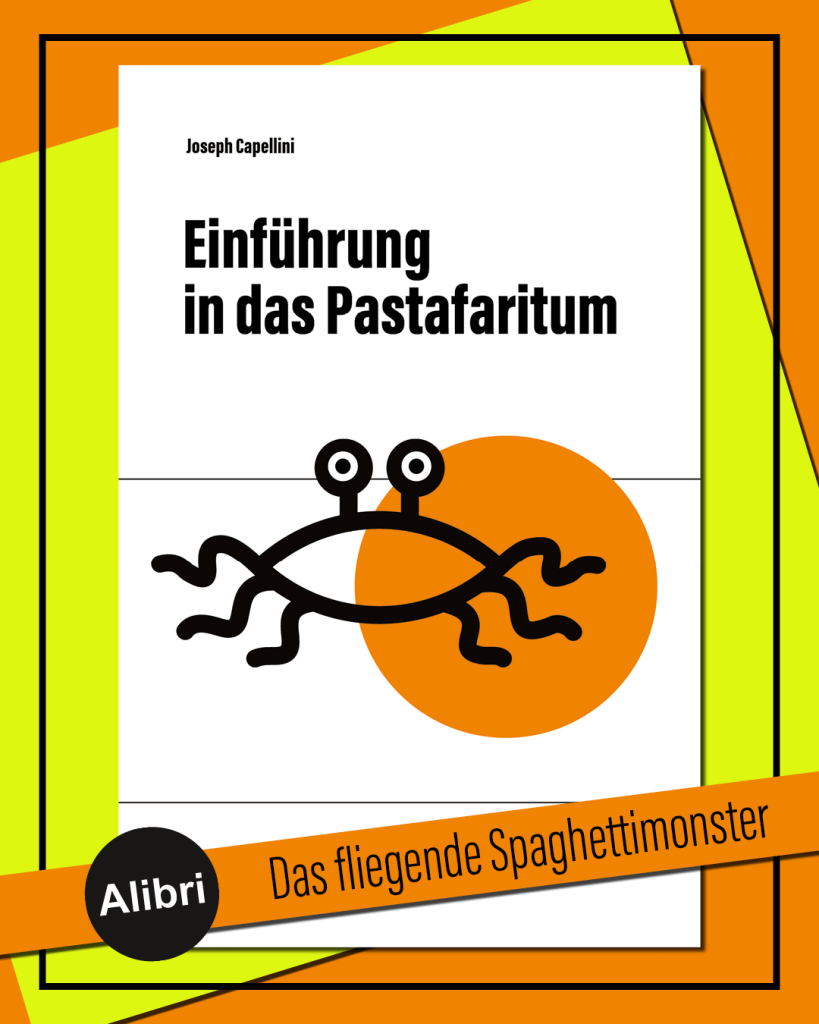
#Kinderbibel
Frage: Meine Nichte ist drei. Sollte ich noch warten?
RAmen😋